Die Autorin wurde vor allem durch „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ bekannt, wovon ich nur die Verfilmung kenne. Auf dieses Buch wurde ich zuerst in einem Katalog aufmerksam und ich habe es zwei Mal gelesen: zuerst 2002 auf Deutsch und sechs Jahre später auf Französisch. Tatsächlich hat es mich sehr gefreut, als ich bei meiner Suche nach französischer Literatur auf eine Übersetzung des ursprünglich englischen Romans stieß, zumal die Geschichte auch in Frankreich spielt, genauer gesagt im Languedoc (wie man im Buch erfährt, erhielt die Region ihren Namen vom dialektalen Wort „oc“ für „Ja“, Languedoc bedeutet also „Sprache des Ja“). So hatte ich die Gelegenheit, mich noch einmal mit der Amerikanerin Ella auf die Spuren ihrer Vorfahren zu begeben, dem charmanten Bibliothekar Jean-Paul zu begegnen und in die Vergangenheit einzutauchen, als Isabelle du Moulin verzweifelt um ein kleines bisschen Selbstbestimmung und Freiheit für sich und ihre Kinder kämpft, während die Familie gleichzeitig als Hugenotten bzw. Calvinisten verfolgt werden.
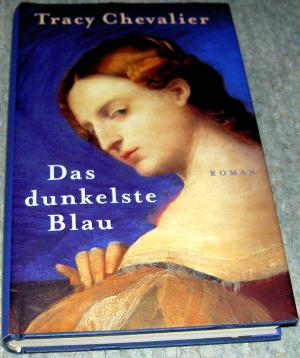
Quelle: Booklooker
Sieht genau aus wie mein Exemplar damals, ich kann mich sogar noch an den Geruch der Seiten erinnern…
Die Handlung ist im Grunde zu komplex, um sie in wenigen Zeilen nachzuerzählen und es würde auch die Lektüre für alle Interessierten verderben. Zu Beginn zieht die Amerikanerin Ella mit ihrem Mann nach Frankreich, weil er dort Arbeit gefunden hat. Sie versuchen schon seit längerer Zeit, ein Kind zu bekommen, bislang erfolglos. Kurz nach ihrer Ankunft in dem kleinen beschaulichen Städtchen Lisle-sur-Tarne meldet sich eine alte Krankheit bei Ella zurück, Neurodermitis. Gleichzeitig hat sie Alpträume, in denen jemand weint und eine Stimme französische Verse spricht, die sie nicht versteht. Parallel dazu entwickelt sich die Geschichte der Hugenottin Isabelle, die als rothaarige und heilkundige Frau im 15. Jahrhundert einen schweren Stand hat. Unglücklich verheiratet und unverstanden von ihrer Familie, ist ihre einzige Freude das leuchtende Blau des Kleids der Jungfrau Maria (daher der Titel), das sie in einer Kirche sieht – die Madonna ist für die Protestanten ein Symbol des verhassten Katholizismus, von daher macht sich Isabelle mit ihrer Vorliebe für diese Farbe nicht beliebt, vor allem nicht bei ihrer strengen Schwiegermutter.
Der Wechsel zwischen den Zeiten und den zwei schicksalhaft miteinander verbundenen Frauen ist ungemein faszinierend, denn beide Erzählstränge sind gleichermaßen spannend und interessant. Zwar weiß der Leser lange nicht, welches finstere Geheimnis aus der Vergangenheit Ella einholt, aber ihre Spurensuche, die sie zu Verwandten in die Schweiz führt, und die sich anbahnende Affäre mit dem Bibliothekar sorgen dafür, dass es niemals langweilig wird. Selbst beim zweiten Lesen wollte ich manchmal nicht aufhören, obwohl es auf Französisch nicht einfach war und ich ohne vorherige Kenntnis der Geschichte der Handlung vermutlich nicht immer hätte folgen können – aber das liegt an meinen Sprachkenntnissen, nicht am Buch. Noch heute erinnere ich mich an den Satz „Je suis un pot cassé“, den Ella im Traum hört und der, wie sich herausstellt, aus dem 31. Psalm stammt, der für die Hugenotten von besonderer Bedeutung war. Die Handlung, eine Mischung aus Detektiv-, Liebes- und Historienroman bildet einen gewissen Kontrast zum sommerlichen Südfrankreich (das man sofort besuchen möchte) und entwickelt einen starken Sog bis zur Aufklärung am Ende. Vielleicht liegt es bei „La vierge en bleu“ mit daran, dass man fremdsprachige Bücher unwillkürlich langsamer liest, weil sie schwerer verständlich sind und sie sich darum stärker einprägen, doch hat „Das dunkelste Blau“ mein 14-jähriges Ich auch auf Deutsch so beeindruckt, dass ich mich sehr sehr gern daran zurückerinnere.